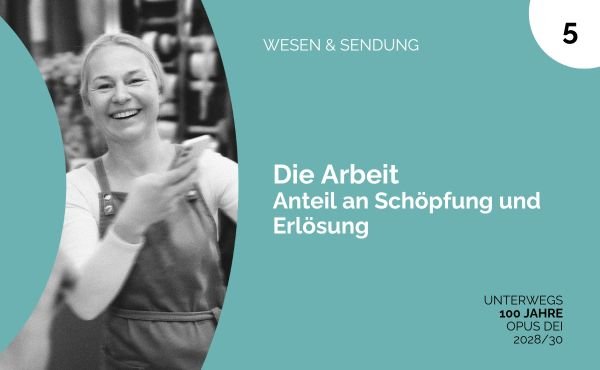Erschaffen nach dem Bild und Gleichnis Gottes, ist der Mensch dazu aufgerufen, in Freiheit an Gottes Schöpfungsplan mitzuwirken. Diese Freiheit wurde allerdings am Anfang auf die Probe gestellt – und erlag dem Hochmut und Egoismus. Seither versagt sie im Verlauf der Geschichte immer wieder. Was die Sünde entzweit, entwürdigt und verwundet – muss jedoch versöhnt, erhoben und geheilt werden. Das Mysterium der Menschwerdung des Wortes, das dem Schöpfungsplan Gottes von Anfang an zugrunde liegt, kommt uns in der Heilsgeschichte als Gabe der Barmherzigkeit und als Geheimnis des Todes und der Auferstehung entgegen.
Die menschliche Arbeit hat Anteil an den zwei Aspekten des einen göttlichen Heilsplans. Im vorausgehenden Artikel wurde der erste behandelt: dass der Mensch durch die Arbeit am göttlichen Plan mitwirkt, die Schöpfung ihrer Vollendung zuzuführen. Die traurige Erfahrung der Sünde und Wunden, die der Menschheit zugefügt wurden, lässt uns nun den zweiten Aspekt betrachten: wie die Arbeit sich in den Heilsplan einfügen kann.
Die Arbeit in Christus ist erlöste und erlösende Arbeit
Indem der Sohn Gottes Mensch wurde, hat er alles erlöst, was er auf sich nahm (vgl. Leo I., Tomus ad Flavianum, DH 293). Er wollte mit uns die Erfahrung der Arbeit und des Alltagslebens teilen, damit der Mensch sich nicht nur an Gottes schöpferischem Tun, sondern auch am Erlösungswerk beteiligen kann. Weil Schöpfung und Erlösung ein einziges göttliches Projekt bilden, sind Frauen und Männer mit ihrer durch Christus erlösten Freiheit gerufen, die Schöpfung der Fülle entgegenzuführen – zu der auch gehört, dass das Gespaltene versöhnt, das Zerstreute gesammelt und das Verletzte geheilt wird.
Die Folgen der Sünde für die menschliche Arbeit beschränken sich ja nicht auf Schweiß und Mühsal (vgl. Gen 3,17-19); die Sünde ist ebenso in der Lage, den Sinn der Arbeit zu entstellen, indem sie diese zu einem Werkzeug des Egoismus, der Ausbeutung und der Gewalt macht. Da jedoch Jesus Christus die Arbeit angenommen und erlöst hat, können wir auch hier, wie die Kirche es in der Osternacht tut, von einer felix culpa, einer glücklichen Schuld, sprechen: Die menschliche Arbeit darf teilnehmen am Erlösungswerk – und erhält dadurch eine noch größere Würde und Bedeutung.
Die Konstitution Gaudium et spes des Zweiten Vatikanischen Konzils kommentiert realistisch, dass alles menschliche Wirken ständig vom Hochmut und der ungeordneten Eigenliebe bedroht ist und durch das Kreuz und die Auferstehung Jesu Christi gereinigt und geheilt werden muss (vgl. Nr. 37). Im unmittelbaren Anschluss daran erläutert das Dokument, wie das menschliche Wirken im Ostergeheimnis erhoben und vervollkommnet wird. Am Beispiel Jesu begreifen wir, dass die Liebe, die die Menschen zur persönlichen Heiligkeit führt, auch das Grundgesetz für die Verwandlung der Welt ist (vgl. Nr. 38). Die erlöste Arbeit ist als Arbeit in Christus vom Dienst und von der Liebe durchdrungen und somit imstande, die Welt gereinigt und geheilt zu Gott zu führen. Das Konzil unterstreicht darüber hinaus den Wert der mit Liebe verrichteten kleinen Dinge. Das Gesetz der Liebe, das die Brüderlichkeit aufbaut und die menschlichen Beziehungen verwandelt, „ist nicht nur in großen Dingen anzustreben, sondern auch und besonders in den gewöhnlichen Lebensverhältnissen“ (vgl. ebd.).
Hl. Josefmaria: Die Arbeit als Werk Gottes
Die Verkündigung des heiligen Josefmaria über die Arbeit, mit der er schon vor dem Konzil begonnen hatte, nimmt dieselbe Perspektive ein. Es ist die Liebe Jesu Christi und die Gnade seines österlichen Geheimnisses, die der Arbeit erlösenden Wert verleihen, indem sie aus ihr ein Werk Gottes machen. Die Liebe ist es, die erlöst und dem, was klein scheint, Größe verleiht: Die menschliche Arbeit, „mag sie auch noch so niedrig und unbedeutend erscheinen, trägt dazu bei, die zeitlichen Gegebenheiten in christlicher Weise zu gestalten, das heißt, ihre übernatürliche Dimension zu offenbaren. Die Arbeit wird so aufgenommen und einverleibt in das wunderbare Werk der Schöpfung und der Erlösung; sie wird zur Ebene der Gnade emporgehoben, wird geheiligt und verwandelt sich in Werk Gottes, in operatio Dei, in opus Dei“ (Gespräche, Nr. 10).
Ausdrücklich bezeichnet der Gründer des Werkes die Arbeit auch einmal als erlöstes und erlösendes Tun: „Die berufliche Arbeit – auch die Arbeit im Haushalt ist ein Beruf ersten Ranges – gibt Zeugnis von der Würde des Menschen als Geschöpf Gottes. Sie ist Mittel zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit, Band, das uns mit den Mitmenschen verbindet, Grundlage unserer materiellen Existenz; ein Beitrag zur Besserung der Verhältnisse in unserer Gesellschaft und zum Fortschritt der Völker … Diese Perspektive erweitert und vertieft sich für einen Christen, denn Christus nahm die Arbeit auf sich und machte sie zu einer erlösten und erlösenden Realität. So ist die Arbeit für uns Mittel und Weg zur Heiligkeit – ein konkretes Tun, das wir heiligen und das uns heiligt“ (Im Feuer der Schmiede, Nr. 702).
Durch die Teilnahme an der Erlösung erhält die Arbeit ihren vollen Sinn
Wenn der heilige Josefmaria über die Sendung des Opus Dei und die Implikationen dieses Berufungsweges in der Kirche sprach, stellte er die Arbeit als ein göttliches Werk vor: als eine Tätigkeit, die nicht auf die Ebene der Natur beschränkt bleibt, sondern die Gnade einbezieht. Die Berufung zum Opus Dei zielt so darauf ab, die irdischen Tätigkeiten zu vergöttlichen und die göttlichen Wege der Erde zu erschließen – wie der König Midas geringwertiges und wenig edles Material in Gold verwandelte (vgl. Freunde Gottes, Nr. 308).
Ganz offensichtlich ist es nicht der Mensch, der das Menschliche vergöttlicht. Gott selbst ist es, der unserem Tun erlösenden Wert gibt. Daher die Notwendigkeit, in Christus zu arbeiten, als Kinder Gottes, die an der Sendung des fleischgewordenen Wortes in der Geschichte teilhaben. So sagt der heilige Josefmaria zu seinen geistlichen Söhnen und Töchtern: „Wenn ihr arbeitet, vollzieht ihr keine bloß menschliche Tätigkeit, denn der Geist des Werkes führt euch dazu, sie in ein göttliches Werk zu verwandeln. Mit Gottes Gnade verleiht ihr eurer beruflichen Arbeit inmitten der Welt ihren tiefsten und vollen Sinn, wenn ihr sie auf die Rettung der Seelen ausrichtet, wenn ihr sie auf die Erlösersendung Christi hinordnet“ (Brief 14, Nr. 20).
Heiligung unseres Tuns an dem Ort, an den Gott uns gestellt hat
Ein bedeutender Teil des Gründungslichtes, das dem heiligen Josefmaria zuteilgeworden ist und er an jene weitergab, die ihm folgten, bestand in folgender Überzeugung: dass eine große Zahl von Männern und Frauen kraft der Taufe dazu berufen sind, sich zu heiligen, ohne ihren Platz und ihre gewohnte Umgebung zu verlassen. Ihre Sendung besteht darin, die gewöhnlichen Tätigkeiten zur Ordnung der Gnade zu erheben.
Der Gründer des Werkes predigte einmal: „Der Herr hat uns nicht erschaffen, damit wir hier eine bleibende Stätte errichten (vgl. Hebr 13,14), denn diese Welt ist der Weg zur künftigen, die eine Wohnung ohne Leiden sein wird (Jorge Manrique, Coplas, V). Trotzdem dürfen wir als Kinder Gottes den irdischen Tätigkeiten nicht den Rücken kehren, denn Gott selbst stellt uns in sie hinein, damit wir sie heiligen und sie mit unserem Glauben durchdringen – dem einzigen, der wahren Frieden und echte Freude in die Seelen und in die verschiedenen Lebensbereiche bringt. Das ist seit 1928 das ständige Thema meiner Verkündigung: Es tut dringend not, die Gesellschaft zu verchristlichen und in alle Bereiche dieser unserer Welt den Sinn für das Übernatürliche zu tragen. Wir alle müssen darum bemüht sein, unser tägliches Tun, unsere Arbeit, unseren Beruf in die Dimension der Gnade hineinzustellen. Dann werden alle menschlichen Tätigkeiten in einer neuen Hoffnung erstrahlen, die über die Zeit und die Vergänglichkeit dieser Welt hinausweist“ (Freunde Gottes, Nr. 210).
Die Welt mit Gott versöhnen
Wie sich aus den Schriften des Gründers des Opus Dei ergibt, sind die Arbeit und die weltlichen Tätigkeiten der Christen Mittel, durch die sich die Erlösung ausweitet auf die ganze Welt. Durch sie gelangt die Gnade bis in die verborgensten Fugen des menschlichen Tuns, ja selbst zu jenen Wirklichkeiten, die wir oft als rein profan betrachten: „Die Aufgabe des Christen besteht darin, die ganze Welt von innen her zu verchristlichen und damit aufzuzeigen, dass Jesus Christus die ganze Welt erlöst hat“ (Gespräche, Nr. 112).
Dabei kommt es nicht darauf an, worin ob unser Tun von großer menschlicher Tragweite ist oder nicht. „Christus ist in den Himmel aufgefahren, aber Er hat uns die Möglichkeit hinterlassen, alles, was im menschlichen Bereich gut ist, zu erlösen“ (Christus begegnen, Nr. 120). „Der Christ lebt mit vollem Recht in der Welt, da er Mensch ist. Wenn er zulässt, dass Christus in seinem Herzen wohnt, dass Christus darin herrscht, dann wird sein ganzes menschliches Tun von der erlösenden Wirksamkeit des Herrn geprägt sein. Ob dann dieses Tun als hoch oder niedrig eingestuft wird, ist dabei unerheblich, denn was in den Augen der Menschen als hoch gilt, kann vor Gott sehr niedrig sein, und was wir gering oder bescheiden nennen, kann aus christlicher Sicht einen hohen Rang haben, den Rang von Heiligkeit und Dienst“ (Christus begegnen, Nr. 183).
Die Gläubigen werden zu Miterlösern
Zu behaupten, dass die Arbeit am Erlösungswerk teilhat, heißt, dass die arbeitenden Männer und Frauen in Christus am Heil der Welt mitwirken. Durch eine gut verrichtete, mit Dienstgeist und Liebe zum Nächsten vollbrachte Arbeit trägt jeder Getaufte zur Heilung der Wunden der Sünde bei; er macht die Gesellschaft menschlicher und gibt der Schöpfung ihre ursprüngliche Schönheit wieder.
Dieser Gedanke findet sich laufend in den Schriften des heiligen Josefmaria, in denen die Worte „versöhnen“ und „neuordnen“ oft als Synonyme für das Wort „erlösen“ verwendet werden, nicht selten im Zusammenhang mit der Errichtung des Reiches Christi: „Der Herr ruft uns, damit wir uns Ihm mit dem Wunsch nähern, Ihm gleich zu werden: Nehmt Gott zum Vorbild als seine geliebten Kinder (Eph 5,1). So können wir demütig, aber kraftvoll an dem göttlichen Plan mitwirken: zu einen, was getrennt ist, zu retten, was verloren ist, zusammenzufügen, was durch den sündigen Menschen aus den Fugen geraten ist, zu einem guten Ende zu führen, was verfahren ist, und die gottgewollte Eintracht der ganzen Schöpfung wiederherzustellen“ (Christus begegnen, Nr. 65).
„Christus unser Herr wurde gekreuzigt, und Er erlöste, am Kreuz erhöht, die Welt, Er stellte den Frieden zwischen Gott und den Menschen wieder her. Uns alle erinnert Jesus Christus daran: Et ego, si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum (Joh 12,32), wenn ihr mich an die Spitze aller menschlichen Tätigkeiten stellt, wenn ihr in jedem Augenblick eure Pflicht erfüllt, wenn ihr meine Zeugen im Großen wie im Kleinen seid, omnia traham ad meipsum, dann werde ich alles an mich ziehen. Mein Reich wird unter euch Wirklichkeit sein!“ (Christus begegnen, Nr. 183).
Zwei theologische Perspektiven auf die Arbeit
Die Lehren des Gründers des Opus Dei über den erlösenden Wert der Arbeit fügen sich auf natürliche Weise in zwei große theologische Perspektiven ein, die das kirchliche Lehramt und die Liturgie aufgegriffen und entfaltet haben: dass das christliche Volk kraft der Taufe ein priesterliches Volk ist und dass die menschliche Arbeit eine eucharistische Dimension besitzt.
Die Beteiligung der Gläubigen am Erlösungswerk erfolgt mittels des gemeinsamen Priestertums, das alle mit der Taufe empfangen haben. Petrus und Paulus sprechen im Neuen Testament von einem geistigen Kult, den die Gläubigen durch ihr ganzes Leben Gott erweisen (vgl. 1 Petr 2,5; Röm 12,1). Im zweiten Kapitel von Lumen gentium stellen die Konzilsväter das Volk Gottes als ein priesterliches Volk dar und verleihen so der Lehre vom gemeinsamen Priestertum der Gläubigen neue Aktualität: „Durch die Wiedergeburt und die Salbung mit dem Heiligen Geist werden die Getauften zu einem geistigen Bau und einem heiligen Priestertum geweiht, damit sie in allen Werken eines christlichen Menschen geistige Opfer darbringen und die Machttaten dessen verkünden, der sie aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat“ (Lumen gentium, Nr. 10).
Und bei einer Altarweihe im Jahr 1975 erklärte der heilige Josefmaria, dass der Leib der Christen und die Werke, die sie verrichten, sich in einen Altar verwandeln: „Immer wenn ich einen Altar weihe, versuche ich, persönliche Konsequenzen daraus zu ziehen. Seht nur, was mit einem Altar geschieht, um ihn Gott zu weihen. Als erstes wird er gesalbt. Man hat euch und mich gesalbt, als wir Christen wurden: auf die Brust, auf den Rücken, mit dem heiligen Öl. Man hat uns am Tag der Firmung gesalbt. Uns Priestern wurden die Hände gesalbt. Und ich hoffe mit der Gnade des Herrn, dass man uns salbt am Tag der letzten Ölung, vor der wir uns nicht fürchten. Was für eine Freude, sich vom Tag der Geburt bis zum Sterben gesalbt zu wissen, Altar Gottes, Eigentum Gottes, Ort, wo Gott sein Opfer vollbringt. Das ewige Opfer nach der Ordnung des Melchisedech“ (AGP, P01 1975, S. 824, zit. in A. Vázquez de Prada, Der Gründer des Opus Dei, Band III, Adamas, Köln 2008, S. 688 f.).
Der Arbeitstisch – ein Altar
Für den Gründer waren die Heiligung der Arbeit und das gemeinsame Priestertum der Gläubigen zwei voneinander untrennbare Dimensionen ein und derselben Wirklichkeit. Häufig hat er die Aufforderung ausgesprochen, mit priesterlicher Seele zu handeln, wobei er meist im selben Atemzug von der Notwendigkeit sprach, eine laikale Mentalität zu pflegen. Damit unterstrich er, dass sich die Ausübung des gemeinsamen Priestertums nicht auf ein paar religiöse Übungen beschränkt, sondern gerade durch den Einsatz in den zeitlichen Wirklichkeiten zum Ausdruck kommt, wie er der säkularen Berufung der gläubigen Laien entspricht (vgl. Brief 25, Nr. 3; Brief 10, Nr. 1; vgl. auch Im Feuer der Schmiede, Nr. 369, Gespräche, Nr. 117).
Die Gläubigen stellen ihre priesterliche Seele daher nicht nur dadurch unter Beweis, dass sie beten, Andachten pflegen oder in apostolischen Werken tätig sind, und auch nicht allein dadurch, dass sie die täglichen Schwierigkeiten geduldig aufopfern. Für den heiligen Josefmaria sind die privilegierten Bereiche der Betätigung des gemeinsamen Priestertums die Arbeit und die täglichen Beschäftigungen, von denen der Tag derer voll ist, die inmitten der Welt leben. Er lehrte, dass der Arbeitstisch gleichsam ein Altar ist, und fügte hinzu, dass auch das Ehebett der Gatten ein solcher ist, womit er unterstrich, dass er „Arbeit“ im weiten Sinn auf das gesamte Alltagsleben und die Pflichten des eigenen Standes bezog. Für jeden Christen weist die Arbeit Analogien zur heiligen Messe auf: zu einer Messe, die den ganzen Tag dauert.
„Ihm nicht nur am Altar dienen, sondern auf der ganzen Welt, die für uns Altar ist. Alle Werke der Menschen werden gleichsam auf einem Altar vollzogen, und jeder von euch feiert in dieser Einheit kontemplativer Menschen, die euer Alltag ist, gleichsam seine Messe, die vierundzwanzig Stunden dauert, bis zur Messe des nächsten Tages, die wiederum vierundzwanzig Stunden dauert, und so bis zum Ende eures Lebens“ (Mitschrift einer Betrachtung, 19.3.1968, zit. bei J. Echevarría, Vivir la Santa Misa, Rialp, Madrid 2010, S. 17).
Alle irdischen Tätigkeiten, in denen die Gläubigen die christlichen Tugenden üben – die Sorge für die Familie, das Zeugnis in der Gesellschaft, die in christlichem Geist gelebte Erholung und Entspannung –, strömen gleichsam in jener Messe zusammen, von der der heilige Josefmaria sprach. Dabei nimmt die Ausübung der Arbeit, sei sie intellektueller oder manueller Art, offensichtlich einen bevorzugten Platz ein. In einem familiären Beisammensein in Lateinamerika meinte er, dass ein Chirurg, der sich beim Betreten des Operationssaales die Handschuhe überstreift, diese Geste so verstehen kann, als legte er wie der Priester, der die Messe feiert, die Paramente an. In ähnlicher Weise kann ein kleines Kruzifix, das neben den Büchern auf dem Studiertisch liegt, daran erinnern, dass für einen modernen Apostel eine Stunde Studium eine Stunde Gebet ist. Die Anstrengung und der intellektuelle Einsatz verwandeln sich dann, wenn sie auf den Dienst am Nächsten und auf das allgemeine Wohl ausgerichtet sind, in eine Gott wohlgefällige Opfergabe (vgl. Der Weg, Nr. 277, 302, 335).
Die eucharistische Dimension der Arbeit
In seiner Verkündigung des heiligen Josefmaria über die Heiligung der irdischen Tätigkeiten geht die Aufforderung, mit priesterlicher Seele zu arbeiten, mit einer theologischen Überzeugung einher, die der Arbeit eine tiefe eucharistische Dimension zumisst. Die christliche Tradition aller Zeiten bringt diese Perspektive einschlussweise zum Ausdruck, wenn sie von der Aufopferung der Arbeit spricht, einer im Leben vieler Christen tief verwurzelten Andacht. Die Arbeit ist in diesem Sinn ein Opfer, das Gott dargebracht wird. Worin aber besteht dieses Opfer eigentlich? Geht es nur darum, Gott die Anstrengung und die Überwindung zu schenken, die die Arbeit mit sich bringt, als wäre sie eine Form von Gebet?
Die eucharistische Dimension der Arbeit reicht weiter als die äußeren Umstände – wie die Schwierigkeiten – oder die inneren Empfindungen – wie Anstrengung und Überwindung. Die Arbeit ist eucharistische Gabe, weil sie die Materie der Welt verwandelt und sie Gott weiht. Analog zu der bei der heiligen Messe erfolgenden Wandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi bewirkt die christliche Arbeit eine Transformation: die Umgestaltung der Welt, damit sie Gottes Plänen mehr und mehr entspricht. Christlich arbeiten heißt, den menschlichen Tätigkeiten eine neue Form geben, die Form der Liebe Christi. Durch die Arbeit kann der Christ das, was durch seine Hände geht, verwandeln und auf diese Weise weihen (vgl. Lumen gentium, Nr. 34). So kann, wer arbeitet, die Wahrheit dorthin tragen, wo Lüge ist, Vertrauen dorthin, wo Verdacht herrscht, Güter dorthin, wo es Armut gibt, Liebe dorthin, wo Feindschaft besteht, Einheit dorthin, wo Spaltung ist, und er kann Krankheiten sowohl körperlicher als auch seelischer Art heilen.
Die Arbeit, hineingenommen in das Opfer Christi
Die eucharistische Dimension der Arbeit tritt besonders deutlich zutage in der Liturgie der heiligen Messe, die von der Kirche in Treue zu den Worten und Gesten Jesu gefeiert wird. Während im Alten Bund die direkt von der Erde genommenen Früchte oder die Tiere der Herde auf dem Altar geopfert wurden, werden im christlichen Gottesdienst Wein und Brot zum Altar gebracht. Es handelt sich nicht um Dinge, die die Natur fertig zur Verfügung stellt, sondern für deren Herstellung menschliche Arbeit erforderlich ist. Darauf verweist der Ritus der Gabenbereitung in dem nach dem II. Vatikanischen Konzil erneuerten Messbuch, wenn es Brot und Wein als „Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit“ bezeichnet.
So wird die menschliche Arbeit auf staunenswerte Weise in den höchsten Akt der Erlösung hineingenommen – in das Opfer des Kalvarienbergs, das in jeder eucharistischen Feier unblutig vergegenwärtigt wird. Die Arbeit eines Arztes oder einer Lehrerin, eines Informatikers oder einer Krankenschwester, eines Arbeiters oder einer Schauspielerin, eines Künstlers oder eines Ingenieurs, eines Kochs oder einer Unternehmerin, eines Advokaten oder eines Politikers, der Einsatz eines Vaters oder einer Mutter bei der Erziehung ihrer Kinder, ja überhaupt all die unzähligen ehrbaren Tätigkeiten, aus denen sich die Vielfalt menschlichen Wirkens zusammensetzt, haben Platz auf diesem Altar. Alle können dargebracht werden zusammen mit der Arbeit, die zur Herstellung von Brot und Wein notwendig war, und damit teilhaben am Erlösungsgeheimnis Christi. So erklärte der heilige Josefmaria: „Jede Arbeit – selbst die verborgenste und unbedeutendste –, die aus Liebe zu Gott getan wird, strahlt die Kraft des göttlichen Lebens aus!“ (Im Feuer der Schmiede, Nr. 49).
Das tägliche Leben als Ort der Begegnung mit Christus
Es gibt einen wichtigen Moment im Leben des Gründers des Opus Dei, in dem seine Lehre über die eucharistische Dimension der Arbeit bildhaft besonders deutlich zum Ausdruck kam. Das war die Feier der heiligen Messe in Pamplona, auf dem Campus der Universität von Navarra, am 8. Oktober 1967:
„Achtet für einen Augenblick auf den äußeren Rahmen unserer Eucharistie, unserer Danksagung: Wir befinden uns in einem einzigartigen Gotteshaus: Das Kirchenschiff ist der Campus der Universität, das Altarbild die Universitätsbibliothek, dort stehen die Maschinen zur Errichtung neuer Gebäude, und über uns wölbt sich der Himmel von Navarra ... Bestätigt euch dieses Bild nicht in klarer und unvergesslicher Weise, dass das alltägliche Leben der wahre Ort eurer christlichen Existenz ist? Dort, meine Kinder, unter euren Mitmenschen, in euren Mühen, eurer Arbeit und eurer Liebe, dort ist der eigentliche Ort eurer tagtäglichen Begegnung mit Christus. Dort, inmitten der durch und durch materiellen irdischen Dinge müssen wir uns bemühen, heilig zu werden, indem wir Gott und allen Menschen dienen“ (Gespräche, Nr. 113).
Nach dieser Darlegung der Teilhabe der menschlichen Arbeit am Werk der Schöpfung und der Erlösung sollen in den folgenden Artikeln andere Lehren des heiligen Josefmaria aufgegriffen und erläutert werden. Wir werden sehen, wie sich die menschliche Arbeit, die Alltagstätigkeiten und die Berufung zum Opus Dei wechselseitig erhellen und so einen spezifischen Weg der Teilhabe an der Sendung des fleischgewordenen Wortes sichtbar machen: als Söhne und Töchter im Sohn.
Alle bisher erschienenen Beiträge aus der Reihe „Unterwegs zur Hundertjahrfeier“ (November 2025)
- Teil 1: Berufung, Sendung und Charisma Die Besonderheit der Berufung im Opus Dei im Kontext der allgemeinen Berufung zur Heiligkeit, das Spezifikum der Sendung des Opus Dei in der Kirche und der Zusammenhang von Berufung, Sendung und Charisma – ein Überblick.
- Teil 2: Die spezifische Sendung des Opus Dei aus der Warte des heiligen Josefmaria Dieser zweite Artikel in der Reihe zur Vorbereitung auf die Hundertjahrfeier soll ein tieferes Verständnis vom spezifischen Ziel und Auftrag des Opus Dei ermöglichen. Die Originaltexte stammen aus persönlichen Betrachtungen und Lehren des Gründers.
- Teil 3: Eine christologische Sicht der Arbeit Inspiriert von der Heiligen Schrift und dem Geheimnis der Menschwerdung lehrte der heilige Josefmaria, dass die Arbeit nicht nur ein möglicher, sondern ein vorzüglicher Ort ist, um die Heiligkeit zu erlangen.
- Teil 4: Arbeit als Teilhabe am Projekt Gottes Im Einklang mit der biblischen Tradition und dem kirchlichen Lehramt – das sich unter Leo XIII. dem Thema entschieden zuwandte – erinnerte der heilige Josefmaria an die hohe Würde der Arbeit. Sie liegt in der aktiven Mitwirkung des Menschen an der Vervollkommnung der geschaffenen Welt.
- Teil 5 (siehe oben): Die Arbeit im Blick auf die Erlösung: Die verwandelnde und erlösende Kraft der geheiligten menschlichen Arbeit steht im Zentrum der Lehre des heiliger Josefmaria.
Diese Artikelreihe wird koordiniert von Prof. Giuseppe Tanzella-Nitti. Er wird von mehreren Mitarbeitern unterstützt, darunter einigen Professoren und Professorinnen der Päpstlichen Universität vom Heiligen Kreuz (Rom).