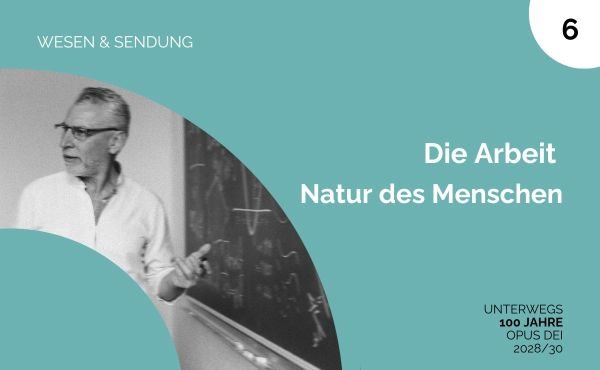Wenn wir den geschichtlichen Werdegang der Menschheit betrachten, stellen wir überrascht fest, wie sich die Arbeit im Laufe der Jahrhunderte gewandelt hat. Erst vor etwa 12.000 Jahren begannen unsere Vorfahren, die zuvor als Jäger und Sammler lebten, Felder zu bestellen und Tiere zu züchten, und wurden dabei immer produktiver. Die Entwicklung mechanischer Werkzeuge von rudimentären zu immer komplexeren Geräten veränderte das Handwerk, die Landwirtschaft, das Bauwesen und die Textilproduktion. Die Energie, die anfangs von Naturelementen und der Muskelkraft von Tier und Mensch abhing, wurde ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts durch Dampfmaschinen und später durch Verbrennungsmotoren und Strahltriebwerke ersetzt. Der Fortschritt der Wissenschaft ermöglichte die Entdeckung und Nutzung der Elektrizität, die Übertragung elektromagnetischer Wellen und die Beherrschung der Kernenergie. Im 20. Jahrhundert hielt die Technologie Einzug in die Arbeitswelt. In den letzten Jahrzehnten beschleunigten Mikroprozessoren die Informationsverarbeitung und übernahmen die Steuerung von Maschinen. Sie veränderten die Art und Weise, wie wir bauen, uns fortbewegen, kommunizieren, lehren und lernen. Sie haben unsere Arbeitsweise verändert – und werden sie weiter verändern.
Verschiedene Sichtweisen auf die menschliche Arbeit
Gibt es inmitten dieser steten Entwicklung etwas Beständiges? Was definiert die menschliche Arbeit in anthropologischer Hinsicht, abseits all dieser Veränderungen? Im Gegensatz zu anderen Lebewesen arbeitet der Mensch nicht nur, um seine Grundbedürfnisse wie Überleben, Ernährung oder Fortpflanzung zu befriedigen, sondern ist auch in der Lage, die Zukunft zu planen, seine Umgebung im Interesse seiner sozialen Bedürfnisse zu gestalten, Kunstwerke zu schaffen und Wissen an nachfolgende Generationen weiterzugeben, wodurch Fortschritt möglich wird. Letztendlich hält uns die Arbeit am Leben.
Dennoch genoss die Arbeit in der Antike – sowohl in der griechisch-römischen Kultur als auch in anderen außerbiblischen Traditionen – kein besonderes Ansehen. Sie galt vielmehr als etwas Knechtisches, als Ausdruck eines mühevollen und sklavischen Lebens. Die wahre Erfüllung des Lebens lag in der Muße, verstanden als Möglichkeit, sich intellektuellen Vergnügungen wie der Philosophie oder verschiedenen Formen der Zerstreuung und des Genusses zu widmen. Vielleicht erklärt sich daraus, dass in späteren Jahrhunderten manche Strömungen der christlichen Askese die Arbeit lediglich als ein Mittel betrachteten, um beschäftigt zu bleiben und den Gefahren des Müßiggangs zu entfliehen.
Die moderne und zeitgenössische Philosophie befasst sich häufig mit dem Verhältnis zwischen Menschen und Technik und schwankt dabei gerne zwischen zwei Extremen: einerseits einem Optimismus, der darauf vertraut, dass uns die Geschichte immer größere Errungenschaften bescheren wird – bis hin zur Überwindung der Arbeit durch den vollständigen Ersatz des Menschen durch die Maschine; und andererseits einem Weltuntergangs-Pessimismus, der befürchtet, ein unkontrollierter technisch-wissenschaftlicher Fortschritt würde letztlich zur Zerstörung der Menschheit und des Planeten führen, der sie ernährt.
Der übersehene Schatz: der spirituelle Wert der Arbeit
Bekanntlich haben sich Theologie und Lehramt der Kirche ausführlich mit der Arbeit befasst und vor allem ihre ethische und moralische Dimension in den Blick genommen. So ist die Soziallehre der Kirche entstanden. Weit weniger entwickelt wurde hingegen die Reflexion über den spirituellen Wert der Arbeit. Es gibt nicht viele Autoren oder Dokumente, die sich der Arbeit im geistlichen Leben des Christen widmen: der Arbeit als Ort des Dialogs zwischen Gott und Mensch sowie als Raum für die Verkündigung des Evangeliums und den Aufbau des Reiches Gottes.
Der Gründer des Opus Dei lehrte nämlich, dass die Arbeit – und mit ihr das Alltagsleben – ein Ort der Begegnung mit Gott ist und damit der Bereich, in dem die Mehrheit der Menschen nach Heiligkeit streben kann. Die Arbeit schafft ein Netzwerk menschlicher Beziehungen, das das christliche Apostolat begünstigt, und ist Stoff, den es zu heiligen gilt, um die Gesellschaft, in der wir leben, christlicher – und damit menschlicher – zu machen. Tatsächlich kann man von einer spezifischen Berufung zur Heiligkeit in und durch die Arbeit sprechen. Das bevorstehende Hundertjahrjubiläum der Gründung des Opus Dei (1928-2028) bietet eine günstige Gelegenheit, die Aktualität dieser Botschaft wiederzuentdecken und ihren Beitrag zur Sendung der Kirche und zum gesellschaftlichen Leben in einer Welt zu würdigen, in der immer neue Arbeitsformen die Gegenwart prägen und die Zukunft bestimmen.
Schöpfungsauftrag, nicht Strafe
Wer sich mit den Lehren des Gründers des Opus Dei befasst, ist oft überrascht, wie sehr er die Würde der Arbeit hervorhebt. Er leitet sie von der Schöpfung ab, bevor es zur Sünde Adams kam:
„Die Arbeit ist kein Fluch, keine Strafe für die Sünde – seit 1928 predige ich das. Im Buch Genesis lesen wir, dass die Arbeit schon vor der Rebellion des Menschen gegen Gott da war: von Anbeginn an war die Arbeit als ein Mitwirken am gewaltigen Werk der Schöpfung in den göttlichen Plan einbezogen“ (Freunde Gottes, Nr. 81).
„Prägt es euch gut ein: Die Pflicht zu arbeiten ist weder eine Folge der Erbsünde noch eine Erfindung der Neuzeit. Die Arbeit ist vielmehr ein notwendiges Mittel, das Gott uns auf Erden anvertraut. Er gibt uns die Tage und lässt uns an seiner Schöpfermacht teilhaben, damit wir uns unseren Lebensunterhalt verdienen und gleichzeitig Frucht für das ewige Leben sammeln (Joh 4,36): Der Mensch wird geboren zur Arbeit, die Vögel zum Fluge (Ijob 5,7)“ (Freunde Gottes, Nr. 57).
Die Arbeit ist daher die Ausgangsbedingung und natürliche Berufung jedes Menschen: „Die Arbeit ist die ursprüngliche Berufung des Menschen und ein Segen Gottes. Sie als eine Strafe anzusehen, ist ein beklagenswerter Irrtum. Gott, der beste aller Väter, stellte den Menschen in das Paradies, ut operaretur – damit er arbeite“ (Die Spur des Sämanns, Nr. 482).
Um den Sinn und Wert der Arbeit zu verstehen, darf man also nicht von der Sünde und ihren Folgen ausgehen, sondern muss vom Bild Gottes ausgehen, das jedem Menschen eingeprägt ist. Die Gründung, zu der sich der heilige Josefmaria in der Kirche berufen fühlte, hat gerade die Aufgabe, die ursprüngliche Würde der Arbeit erneut aufzuzeigen:
„Gewiss, meine Töchter und Söhne, als wir zum Opus Dei kamen und so handelten, haben wir nichts anderes getan, als daran zu erinnern, dass Gott wollte, dass wir die Arbeit lieben. Wenn die Schrift die Erschaffung des ersten Menschen schildert, berichtet sie uns, dass Jahwe den Menschen nahm und ihn in den Garten Eden setzte, ut operaretur, damit er arbeite (Gen 2,15). Nach der Sünde bleibt die gleiche Realität der Arbeit bestehen, die nun – aufgrund dieser Sünde – mit Schmerz und Mühe verbunden ist: Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen (Gen 3,19), heißt es in der Genesis. Die Arbeit ist nicht etwas Nebensächliches, sondern Gesetz für das Leben des Menschen“ (Brief 14, Nr. 3).
Tatsächlich geht es darum, an etwas zu „erinnern“, das bestimmte Lesarten der Genesis vielleicht übersehen haben: Die Arbeit ist nicht Strafe, sondern Segen. Unsere Stammeltern erhielten von Gott nicht einen Befehl oder eine knechtische Aufgabe übertragen, sondern wurden von ihm tatsächlich gesegnet: Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und macht sie euch untertan; herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über alle Tiere, die auf dem Land kriechen (Gen 1,28). Nichts liegt dem biblischen Geist ferner, als die Arbeit als Fluch zu betrachten. Nach Adams Sünde bleibt der Mensch weiterhin der „Bebauer“ und „Behüter“ der Erde, wie es der Schöpfer gewünscht hatte. Allerdings ist seine Arbeit nun von Anstrengung, Unsicherheit und Ungewissheit gezeichnet. Doch obwohl er der Gefahr der Sünde ausgesetzt ist – wie die Episode vom Turmbau zu Babel zeigt (vgl. Gen 11,1-9) –, kann der Mensch durch sorgfältige und gewissenhafte Arbeit Gott ehren: Er baut Altäre, fertigt die Bundeslade an, errichtet den Tempel in Jerusalem.
Berufliche Berufung und universaler Ruf
Die Einzigartigkeit der Arbeit als existenzielle Dimension des menschlichen Lebens sowie die Vielfalt der Formen, in denen sich menschliches Handeln ausdrückt, veranlassen den heiligen Josefmaria, zwei grundlegende Gedanken zu formulieren. Der erste ist, dass die Berufung zur Heiligkeit in der Welt die menschlich-berufliche Berufung irgendwie einschließen muss, der jeder bereits nachkommt oder auf die er sich vorbereitet:
„Seid sicher, dass die Berufung zum Beruf ein wesentlicher, untrennbarer Bestandteil unseres Christseins ist. Der Herr will euch heilig: dort, wo ihr seid, und in dem Beruf, den ihr gewählt habt. Welche Motive auch immer euch zu dieser Wahl bewogen haben: wenn sie nicht im Widerspruch zum Gesetz Gottes stehen, scheinen sie mir alle gut und nobel; sie lassen sich leicht auf die Ebene des Übernatürlichen heben und sie münden in den Strom der Gottesliebe ein, der das Leben eines Kindes Gottes trägt“ (Freunde Gottes, Nr. 60).
Der zweite ist, dass der Ruf zur Heiligkeit in und durch die Arbeit, fast als natürliche Konsequenz, ein universaler Ruf ist – man denke allein an den Reichtum und die Vielfalt der Formen menschlicher Arbeit und der konkreten Umstände des Alltagslebens.
Taufe als Fundament, Arbeit als Weg
Die Universalität der Berufung zur Heiligkeit hat ihre theologische Grundlage nicht in der Arbeit, sondern in der Taufe. Durch sie wird der Gläubige mit Jesus Christus vereint und eingeladen, diese Einswerdung mit ihm ein Leben lang zu vertiefen und ihrer Fülle zuzuführen. Dies gilt für sämtliche Glieder des Gottesvolkes: Amtsträger und Laien, Ordensleute und geweihte Personen, Männer und Frauen, Gesunde und Kranke sind dazu berufen, nach der christlichen Vollkommenheit zu streben.
Die Erkenntnis, dass die Heiligkeit auch in der Ausübung der Arbeit und im gewöhnlichen Leben gesucht werden kann (vgl. Brief 3, Nr. 2), hat den Gründer des Opus Dei zur Schlussfolgerung geführt, dass dieser allgemeine Weg praktisch für alle gangbar ist. So öffneten sich, wie er sagte, die göttlichen Wege der Erde (vgl. Christus begegnen, Nr. 21; Freunde Gottes, Nr. 314). Denn jede Arbeit und jedes alltägliche Tun kann zu einem Ort der Begegnung mit Gott werden (vgl. Freunde Gottes, Nr. 149, 208).
Hier zwei besonders aussagekräftige Texte:
„Meine Kinder, dringt in alle Winkel vor. Wo ein ehrlicher Mensch leben kann, dort finden wir Luft zum Atmen. Dort müssen wir mit unserer Freude sein, mit unserem inneren Frieden und mit unserem Eifer, Seelen zu Christus zu führen. An welchen Orten? Wo die Intellektuellen sind? Wo die Intellektuellen sind. Wo jene sind, die mit ihren Händen arbeiten? Wo jene sind, die mit ihren Händen arbeiten. Und welche von diesen Arbeiten ist die bessere? Ich sage euch wie schon andere Male: Höheren Wert hat die Arbeit, die mit mehr Liebe zu Gott verrichtet wird. Wenn ihr arbeitet und eurem Freund, eurem Kollegen, eurem Nachbarn auf eine Weise helft, dass er es nicht bemerkt, dann heilt ihr ihn; ihr seid Christus, der ihn gesund macht, Christus, der ohne Abscheu mit denen zusammenlebt, die Gesundheit brauchen, wie es auch uns jederzeit passieren kann” (Beisammensein im Teatro Coliseo, Buenos Aires, 23. Juni 1974).
„Kommt es dir nicht auch ziemlich verstiegen vor, wenn du hörst, dass man mitten im Getriebe heilig sein kann und soll? Dass einer heilig sein kann und soll, der auf der Straße Eis verkauft, oder die Hausangestellte, die den Tag in der Küche verbringt, der Bankdirektor, der Universitätsprofessor, der Bauer, der Kofferträger? Alle zur Heiligkeit berufen!“ (Beisammensein in São Paulo, 30. Mai 1974, zitiert in: S. Bernal, Msgr. Josemaría Escrivá de Balaguer. Aufzeichnungen über den Gründer des Opus Dei, Adamas, Köln 1978, S. 107).
Beide Texte – insbesondere der zweite – beschreiben die Universalität der Berufung zur Heiligkeit, indem sie verschiedene Tätigkeiten, Berufe und Beschäftigungen anführen. Wenn jede ehrliche Arbeit geheiligt werden und zu einem Ort der Begegnung mit Gott werden kann, dann ist die Berufung zur Heiligkeit so universal wie die zahllosen Facetten der Arbeitswelt, denen sich Männer und Frauen aller Zeiten widmeten und widmen.
Solange es Menschen auf der Erde gibt
Die Überzeugung des heiligen Josefmaria, dass die neue Gründung, zu deren Aufbau er sich inspiriert fühlt, in der Zeit Bestand haben wird, gründet auf einer einfachen, aber tiefen Gewissheit: Da Arbeit zur natürlichen Bestimmung des Menschen gehört, wird ihre Heiligung immer möglich sein, denn es wird immer möglich sein, zu lieben und im gewöhnlichen Alltag in Gottes Gegenwart zu leben. „Solange es Menschen auf der Erde gibt, wird es das Werk geben“ (Brief 3, Nr. 92).
Der Weg, den er aufzeigt, ist keine laiengerechte Anpassung bestehender christlicher Lebensformen, die – kraft einer besonderen Weihe oder kanonischer Gelübde – die Ganzhingabe an das kontemplative Gebet sowie eine gewisse Abkehr von der Welt verlangen. Der heilige Josefmaria weiß, dass er sich an Menschen wendet, die in die Tätigkeiten der Welt eingebunden sind. Auch sie – Männer und Frauen – können die Höhen eines intensiven Gebetslebens und der Vereinigung mit Gott erreichen. Darauf verweist beispielsweise sein wiederholter Gebrauch des Adjektivs „kontemplativ“ bzw. des Ausdrucks „Beschaulichkeit mitten in der Welt” (vgl. Die Spur des Sämanns, Nr. 497; Im Feuer der Schmiede, Nr. 738, 740), die er auf das gewöhnliche Arbeitsleben eines Christen anwendet. Dieselbe Tiefe des Gebets, die ein kontemplativer Ordensmann in der Abgeschiedenheit von der Welt anstrebt, soll auch ein Arbeiter, eine Mutter, eine Wissenschaftlerin oder ein Künstler erreichen können.
„Als der Herr in diesen Jahren sein Werk erweckte, war es sein Wille, dass niemals mehr die Wahrheit in Vergessenheit gerate, dass alle sich heiligen sollen und dass für die Mehrheit der Christen dies in der Welt zu geschehen hat, in der gewöhnlichen Arbeit. Deshalb wird es das Werk geben, solange es Menschen auf der Erde gibt. Immer wird dieses Phänomen auftreten, dass es Menschen der verschiedensten intellektuellen und manuellen Berufe gibt, die nach der Heiligkeit in ihrem Stand, in diesem ihrem Beruf streben und dabei beschauliche Seelen mitten auf der Straße sind“ (Brief 3, Nr. 92).
Arbeitssoziologen gehen davon aus, dass rund ein Drittel der Kinder, die heute in den Industrieländern geboren werden, später Berufe ausüben werden, die es derzeit noch gar nicht gibt. Diese neuen Berufe werden aus der Dynamik des gesellschaftlichen Lebens und technologischen Fortschritts hervorgehen, lange bevor die Betroffenen in den Arbeitsmarkt eintreten. Trotz dieser rasanten Entwicklungen bleibt die Lehre des heiligen Josefmaria über die Heiligung der Arbeit unverändert gültig, denn sie richtet sich nicht auf die jeweilige Arbeit, sondern auf die Person, die sie verrichtet.
Moderne Arbeitseinstellungen und Einheit des Lebens
Das geistliche Profil, das der Gründer des Opus Dei in seiner Predigt für Christen bietet, die mitten im Gefüge der Welt leben, bietet klare Antworten auf viele Unsicherheiten, mit denen wir heute konfrontiert sind.
In der heutigen Welt wird Arbeit oft als Hindernis empfunden – als etwas, das uns Zeit für uns selbst, für die Familie oder für unsere eigenen Interessen raubt. Das eigentliche Leben, so scheint es, beginnt erst nach Feierabend. Sinnbildlich für diese Sichtweise ist der Gegensatz zwischen Werktagen und Wochenende: Man erträgt die Woche, weil das Wochenende winkt; man hält die langen Monate im Beruf durch, weil schließlich der Urlaub naht. Selbst gläubige Christen meinen oft, erst nach getaner Arbeit Zeit zu finden, sich anderen zuzuwenden, apostolische Aufgaben zu übernehmen, zu beten oder ihr inneres Leben zu pflegen.
Zwar ist diese Wahrnehmung nicht ganz unbegründet – Arbeit beansprucht tatsächlich Zeit und Energie, die dann für anderes fehlt. Sie findet auch nicht selten unter Bedingungen statt, die der Würde des Menschen widersprechen. Doch führt diese Sichtweise unausgesprochen zur Annahme, dass geistliches Leben, Beziehung zu Gott und Aufmerksamkeit für den Nächsten nur außerhalb des Arbeitsgeschehens möglich seien – dort also, wo nicht Alltag herrscht. Die Struktur der Städte scheint diese Logik zu verstärken, indem sie ihre Bewohner dazu drängt, für Freizeit, Erholung und Besinnung besondere Orte aufzusuchen.
In der Verkündigung des heiligen Josefmaria findet sich diese Sichtweise nicht. Im Einklang mit dem Evangelium – Jesus predigte sowohl in den Städten als auch auf dem Land, arbeitete mit seinen Händen und kannte die Bedingungen der menschlichen Arbeit – ruft er zur Einheit des Lebens und zur Heiligung des Alltags auf: Gott begegnet man in der Ausübung der eigenen Arbeit: Sie verhindert nicht das Gebet, sondern kann selbst zu Gebet werden; sie findet ihren Platz auf dem Altar, neben der Eucharistie. Christliches Engagement, Apostolat und das menschliche wie geistliche Wachstum der Gesellschaft entfalten sich oft gerade durch die Arbeit.
Das heißt freilich nicht – wie wir aus eigener Erfahrung wissen –, dass diese Ziele nur im Arbeitskontext erreichbar wären. Doch wird deutlich: Arbeit behindert nicht das Leben und die Sendung der Christen; sie ist vielmehr für viele der natürliche Ort, an dem dieses Leben und diese Sendung ihren Ausdruck finden und sich weiter nähren.
Arbeit als Götzendienst
Viele unserer Zeitgenossen sehen in der Arbeit eine Art Spiegel ihres Selbstbildes und verwandeln ihr berufliches Engagement in Selbstbestätigung. Beruflicher Erfolg wird zur Visitenkarte vor der Welt und bezeugt den Wert des eigenen Ichs. Misserfolg hingegen führt nicht nur zur Enttäuschung, sondern wird zur Bedrohung des Menschen.
Wird aber die Arbeit als privilegierter Raum der Selbstbestätigung verstanden, kann sie leicht zum Gegenstand der „Verehrung” werden, für den man viel zu „opfern” bereit ist: Zeit, Gesundheit, Beziehungen. An diesem Punkt wird die Arbeit – bewusst oder unbewusst – zum Götzen. Und dieser Götze sind wir selbst.
Selbst technologische Werkzeuge können zu Idolen werden, wenn sie nicht auf den Dienst an den anderen und das Gemeinwohl ausgerichtet sind. Nicht zufällig warnt das kürzlich erschienene Dokument des Heiligen Stuhls Antiqua et nova (2025) über die künstliche Intelligenz genau vor dieser Versuchung: unsere tiefsten Erwartungen – das Verlangen nach Beziehungen, Gewissheit, Sicherheit – auf Technologien zu projizieren und sie so zu technologischen Götzen zu machen (vgl. Antiqua et nova, Nr. 105).
Die Kultur der guten Arbeit
Eine kohärente Sicht der Arbeit hingegen – wie das Evangelium sie lehrt und wie der heilige Josefmaria sie neu aufgelegt und weitergegeben hat – hilft uns, die wahre Ordnung menschlicher Bestrebungen zu erkennen: Gott allein die Ehre zu geben, dem Nächsten zu dienen, das Wohl der Gesellschaft zu fördern. Das schließt die Bereitschaft ein, das Opfer des Kreuzes auf sich zu nehmen und vor allem auf Gott zu vertrauen, nicht auf menschliche Sicherheiten.
Die gute Arbeit – mit Kompetenz, Professionalität und Sorgfalt verrichtet, nicht oberflächlich und schlampig –, zu der der Gründer des Opus Dei beharrlich aufforderte, ist nicht nur eine notwendige Voraussetzung, um sie Gott als wohlgefälliges Opfer darzubringen. Sie enthält auch eine transformierende Kraft, die viele Übel unserer Zeit heilen kann.
In einer Epoche, in der Eile oft Vorrang hat vor Besonnenheit, das Streben nach Erfolg um jeden Preis Professionalität, Redlichkeit und Gesetzestreue gefährdet und Angst und Emotion häufig die nüchterne und vernünftige Analyse übertönen, erscheint der Aufruf zur guten Arbeit – auch wenn sie Mühe und Zeit erfordert – als eine geradezu providentielle Einladung. Aus dieser Perspektive ändert sich auch die Bedeutung von Erfolg und Misserfolg.
Kompetenz, Professionalität und Studium bewahren nicht nur vor Fehlern, sondern auch davor, anderen zu schaden oder Ressourcen zu vergeuden. Menschen zu guter Arbeit zu erziehen, ist zweifellos einer der größten Dienste, die man nicht nur der Gesellschaft, sondern auch der Kirche erweisen kann – einer Kirche, die vor der Gefahr des Klerikalismus nicht gefeit ist, wenn es an Kompetenz mangelt oder die Realität und Dynamik der Welt zu wenig verstanden wird.
Fortschritt als Ausdruck der Schöpfung
Zudem ermöglicht das Verständnis der Arbeit als Teilhabe am Schöpfungs- und Erlösungswerk – ein zentraler Gedanke in den Schriften des heiligen Josefmaria – ein ausgewogenes Urteil über den Fortschritt. Technik erscheint dann als legitimer Ausdruck menschlicher Kreativität und als Zeichen der geistigen Dimension des Menschen, der nach Gottes Bild und Gleichnis geschaffen ist.
Aus dieser Perspektive können technisch-wissenschaftlicher Fortschritt und Förderung des Menschen nicht als widersprüchliche Kräfte verstanden werden. Technologie und Ethik, Wissenschaft und Weisheit können – ja, müssen – harmonisch zusammenwirken. Das christliche Denken hängt nicht dem Gedanken an, dass wir „weniger Wissenschaft und mehr Menschlichkeit“ brauchen. Es setzt sich dafür ein und vertritt, dass Menschlichkeit durch Wissenschaft und Forschung wächst.
Die Autonomie und Freiheit, mit der wir den Fortschritt gestalten, sind nicht – wie der heilige Josefmaria sagen würde – absolut, sondern „kindlich“: Wir leben sie als Kinder Gottes, die sich ihrer Berufung zum Dienst bewusst sind. Im Reich Christi bedeutet Herrschaft Dienst. Wo Arbeit von Nächstenliebe und Dienstgeist getragen ist, wird wissenschaftlicher Fortschritt zu echtem menschlichen Fortschritt.
Alle bisher erschienenen Beiträge aus der Reihe „Unterwegs zur Hundertjahrfeier“ (August 2025)
Teil 1: Berufung, Sendung und Charisma Die Besonderheit der Berufung im Opus Dei im Kontext der allgemeinen Berufung zur Heiligkeit, das Spezifikum der Sendung des Opus Dei in der Kirche und der Zusammenhang von Berufung, Sendung und Charisma – ein Überblick.
Teil 2: Die spezifische Sendung des Opus Dei aus der Warte des heiligen Josefmaria Dieser zweite Artikel in der Reihe zur Vorbereitung auf die Hundertjahrfeier soll ein tieferes Verständnis vom spezifischen Ziel und Auftrag des Opus Dei ermöglichen. Die Originaltexte stammen aus persönlichen Betrachtungen und Lehren des Gründers.
Teil 3: Eine christologische Sicht der Arbeit Inspiriert von der Heiligen Schrift und dem Geheimnis der Menschwerdung lehrte der heilige Josefmaria, dass die Arbeit nicht nur ein möglicher, sondern ein vorzüglicher Ort ist, um die Heiligkeit zu erlangen.
Teil 4: Arbeit als Teilhabe am Projekt Gottes Im Einklang mit der biblischen Tradition und dem kirchlichen Lehramt – das sich unter Leo XIII. dem Thema entschieden zuwandte – erinnerte der heilige Josefmaria an die hohe Würde der Arbeit. Sie liegt in der aktiven Mitwirkung des Menschen an der Vervollkommnung der geschaffenen Welt.
Teil 5: Die Arbeit im Blick auf die Erlösung: Die verwandelnde und erlösende Kraft der geheiligten menschlichen Arbeit steht im Zentrum der Lehre des heiliger Josefmaria.
• Teil 6 (siehe oben): Arbeit gehört zur Natur des Menschen: Ausgehend von einem Blick auf die historische Entwicklung der Arbeit reflektiert dieser Beitrag über ihre bleibende Würde und Bedeutung im Leben der Menschen, unabhängig vom Wandel der Arbeitswelt.
Diese Artikelreihe wird koordiniert von Prof. Giuseppe Tanzella-Nitti. Er wird von mehreren Mitarbeitern unterstützt, darunter einigen Professoren und Professorinnen der Päpstlichen Universität vom Heiligen Kreuz (Rom).