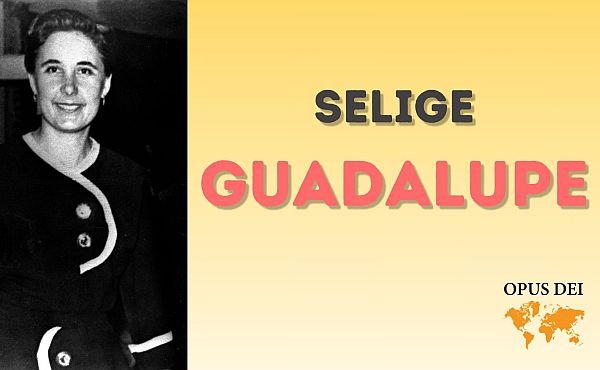Vor fünfzig Jahren starb die selige Guadalupe Ortiz de Landázuri, eine Frau, deren Leben Tag für Tag aus kleinen Schritten bestand und vielen einen großen Sprung ermöglichte – ganz im Sinne der Worte Neil Armstrongs, der als erster Mensch den Mond betrat: „Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit.“ Guadalupe ließ sich immer wieder von Gott überraschen und antwortete mit einer freudig gelebten Berufung, die die Größe der göttlichen Liebe widerspiegelt.
Guadalupe wurde am 12. Dezember 1916 in Madrid geboren – am Fest Unserer Lieben Frau von Guadalupe, der Patronin Lateinamerikas. Sie war das dritte Kind von Manuel Ortiz de Landázuri und Eulogia Fernández de Heredia. Ihr Vater, ein Militärangehöriger, engagierte sich ungewöhnlich intensiv in der Versorgung und Erziehung der Kinder; ihre Mutter war großzügig, entschlossen und treu, wenn auch wenig praktisch. Gemeinsam schufen sie ein Umfeld, das von Freiheit und Verantwortungsbewusstsein geprägt war.
Nach der Übersiedlung der Familie nach Tétouan, der damaligen Hauptstadt des spanischen Protektorats in Marokko, sah sich Guadalupe am Gymnasium als einziges Mädchen einer Bubenklasse gegenüber. Sie gewann jedoch bald deren Respekt – nicht nur durch ihre schulischen Leistungen, sondern auch wegen ihres Mutes. So schlug sie etwa einen Tintentrink-Wettbewerb vor und bestand als Einzige die Probe.
Mit der Berufung des Vaters ins Kriegsministerium kehrte die Familie nach Madrid zurück. Guadalupe, inzwischen 17 Jahre alt, schrieb sich an der Zentraluniversität für ein Chemiestudium ein – als eine von nur fünf Frauen unter sechzig Studenten. Über einen strebsamen Kommilitonen, mit dem sie drei Jahre später gelegentlich ausging, äußerte sie sich gegenüber Freundinnen mit jenem Augenzwinkern, das sie ihr Leben lang begleitete: „Er ist so perfekt, so perfekt – das ist schon zu viel!“ Mit dem Heiraten war es ihr nicht eilig.
Verlangen nach Tiefe
Der Wunsch, die verborgene Wahrheit hinter den Dingen zu entdecken, nicht nur in der Chemie, sondern auch in ihrem persönlichen Leben – das durchzog ihr Denken. Nach dem Spanischen Bürgerkrieg, den ihr Vater nicht überlebte, schloss sie ihr Studium ab und erhielt Lehraufträge an zwei Schulen. Sie war nun 23 Jahre alt, lebte bei ihrer Mutter und begann, ihre Unabhängigkeit zu genießen.
Fünf Jahre später, im Januar 1944, besuchte sie wie jeden Sonntag die Heilige Messe. Trotz anfänglicher Geistesabwesenheit fühlte sie sich in einem Moment wie von der Gnade Gottes berührt. Sie hatte das Gefühl, einen Priester sprechen zu müssen. Ein Familienfreund, den sie nach der Messe traf, vermittelte ihr den Kontakt zu Josefmaria Escrivá. Schon das erste Gespräch mit ihm war, wie sie später berichtete, „entscheidend“. Auf seine Frage, was sie von ihm wolle, antwortete sie spontan: „Ich glaube, ich habe eine Berufung.“ Der Priester erwiderte: „Das kann ich Ihnen nicht sagen“, bot ihr aber geistliche Begleitung und die Beichte an – genau das, was sie suchte. Nach einer Zeit der geistlichen Unterscheidung erkannte sie am Ende von Besinnungstagen ihre Berufung zum Opus Dei. Am 19. März, dem Fest des heiligen Josef, schloss sie sich der jungen Institution als Numerarierin an.
Ohne Anleitung – einfach loslegen
Von Anfang an widmete sich Guadalupe mit Begeisterung und Einsatz allen Bereichen der Arbeit des Werkes: Bildung, Apostolat, praktische Aufgaben. Gerade für Letztere hatte sie – wie ihre Mutter – jedoch kein großes Talent: Sie war vergesslich und hatte Mühe, Ordnung zu halten. Dennoch betraute sie der heilige Josefmaria mit dem Haushalt des Hauses in der Calle Jorge Manrique und sandte sie überdies auf apostolische Reisen nach Bilbao, wo sie mit drei weiteren Frauen die Arbeit des Werkes begann.
1947 kehrte sie nach Madrid zurück und wurde in die Leitung des Werkes in Spanien eingebunden. Sie übernahm ebenso die Führung des Studentinnenwohnheims Zurbarán und schrieb sich gleichzeitig für ein Doktorat in Chemie ein – in fünf Fächern. Im Jahr darauf belegte sie vier weitere und begann ihre Dissertation.
Im Oktober 1949 ließ der heilige Josefmaria sie fragen, ob sie bereit wäre, gemeinsam mit zwei anderen Frauen die apostolische Arbeit des Werkes in Mexiko zu beginnen. Es war das erste Mal, dass das Opus Dei ein Land außerhalb Europas erreichen sollte, und das zu einer Zeit, in der weite Reisen noch selten waren. Guadalupe sagte zu und schrieb dem Gründer: „Man hat mir von Mexiko erzählt. Danke, Vater. Ich wäre, wie Sie wissen, sehr glücklich, auch wenn ich nicht fahren würde – aber ich fahre mit Begeisterung, obwohl ich eigentlich nicht viel darüber nachdenke. Im Gebet widme ich dem Thema täglich eine kurze Weile und bete auch so manchen Rosenkranz zu meiner Jungfrau von Guadalupe, um sie um das zu bitten, was ich noch nicht kenne.“
Am 5. März 1950 begab sie sich auf die Reise. Jahre später erinnerte sie sich: „Ich war die Älteste, obwohl ich noch sehr jung war, aber ich fühlte mich mit jener Ernsthaftigkeit von 80 Jahren, von der ich den Vater so oft hatte sagen hören, dass wir Gott darum bitten sollten, weil wir sie brauchen (...). Der Vater hatte uns gelehrt, Gottvertrauen und völlige Armut zu leben. Wir trugen – wie er immer wieder sagte – die Liebe zu Jesus in uns … und den Wunsch, die göttliche Torheit unserer Berufung weiterzugeben.“
Kaum hatte sie mexikanischen Boden betreten, bemühte sie sich nach Kräften, sich einzuleben: Sie versuchte, die Kultur kennenzulernen, milderte ihren spanischen Akzent – denn das kastilische Spanisch klang für mexikanische Ohren oft hart –, übernahm lokale Redewendungen und passte sogar ihre Kleidung an, indem sie typische Schals und handbemalte Röcke trug.
Keine Scheu vor nichts
Trotz knapper Mittel gründete Guadalupe in der Kopenhagener Straße in Mexiko-Stadt ein Studentinnenwohnheim, das sie – wie zuvor Zurbarán – mit Hingabe leitete. Sie förderte eine intensive kulturelle, gleichzeitig fröhliche und familiäre Atmosphäre und setzte parallel dazu ihr Chemiestudium an der Universität fort.
Die fünf Jahre in Mexiko waren von vielen Erlebnissen geprägt: von Maultierwanderungen durch abgelegene Gegenden – eine angebotene Pistole lehnte sie ab und trug stattdessen lieber einen Dolch, „um nicht ohne Not zu schießen“ – bis zu einem Skorpionstich, den sie während eines katechetischen Vortrags erlitt. Viele Zeugen versichern, dass sie trotz ihres vergleichsweise kurzen Aufenthalts eine tiefe Spur hinterließ – bei den Frauen, denen sie begegnete, und im ganzen Land.
Im Oktober 1956 brach sie erneut zu einem unbekannten Ziel auf: diesmal nach Rom, um dem heiligen Josefmaria bei der Leitung der apostolischen Arbeit in zahlreichen Ländern zu helfen – darunter Chile, Argentinien, Kolumbien, Venezuela, Deutschland, Guatemala, Peru, Ecuador, Uruguay und die Schweiz. Aus Mexiko würde Guadalupe wertvolle Erfahrungen mitbringen.
Neuerliche Wende
Doch wieder kam alles anders. Nach weniger als einem Jahr in Rom fühlte sie sich im März 1957 plötzlich unwohl und war bereits bei kleinen Anstrengungen – etwa beim Treppensteigen – erschöpft. Die Diagnose lautete: Mitralklappenstenose. Auf Empfehlung ihres Bruders Eduardo, der selber Arzt war, wurde sie im Juli in Madrid operiert – erfolgreich, doch die Beschwerden kehrten bald zurück. Noch einmal reiste sie nach Rom, aber das feuchte Klima bekam ihr nicht. Ab 1958 blieb sie dauerhaft in Spanien.
Trotz allem sah sie ihre Krankheit nie als Hindernis, sich mit ganzer Kraft für Gott und andere einzusetzen. So schrieb sie den Frauen in Rom: „Mir geht es sehr gut, und obwohl ich ein stolperndes Herz habe, habe ich jeden Tag mehr Lust zu arbeiten und Dinge zu tun – so bin ich eben.“
1961 übernahm sie neuerlich die Leitung eines Studentinnenheims des Werkes, kümmerte sich um die Schülerinnen der Hauswirtschaftsschule Montelar und arbeitete weiter an ihrer Dissertation – auch dann, wenn sie krank im Bett lag, mit Büchern auf der Decke. Ihre Doktorarbeit über die Isolierung von feuerfestem Material aus Reisspelzasche verteidigte sie 1965 – und schickte dem heiligen Josefmaria am Tag darauf einen feuerfesten Ziegelstein als Anschauungsmaterial sowie eine Kopie ihrer Arbeit mit der Widmung: „Vater, diese Seiten enthalten die Ergebnisse von vielen Stunden Arbeit. Sie wurde soeben mit cum laude benotet, und ich möchte sie mit allem, was ich bin und habe, eilig in Ihre Hände legen, damit sie von Nutzen seien.“
Arbeit, Dienst, Heiligkeit
Von 1960 bis 1975 stand Guadalupe – mit einer kurzen Unterbrechung – als Chemielehrerin im Klassenzimmer. An der Frauenschule für industrielle Fachausbildung begann sie als Assistentin, erlangte später eine Professorenstelle und wurde schließlich zur stellvertretenden Leiterin ernannt, nachdem sie aus gesundheitlichen Gründen auf das Amt der Direktorin verzichtet hatte.
Ab 1965 half sie bei der Planung und ab 1968 bei der Gründung des Zentrums für Studien und Forschung in der Hauswirtschaft (CEICID) – ein Herzensprojekt des heiligen Josefmaria zur Würdigung der Hausarbeit. Auch hier war sie stellvertretende Direktorin und Professorin für Textilchemie. Daneben leitete sie ein Zentrum des Werkes, pflegte ihre Mutter und unterstützte Bildungsprojekte wie Senara.
Ihre letzte Begegnung mit dem Gründer am 15. Mai 1974 beschrieb sie als „innigen Dialog, in dem die Grenzen zwischen seinen Worten und meinen Gedanken verschwanden und ich spürte – wie auch schon bei früheren Begegnungen –, dass ich durch seinen greifbaren Glauben Gott berührte.“ Kurz darauf erkrankte ihre Mutter schwer und wurde in die Universitätsklinik von Navarra in Pamplona eingeliefert, wo ihr Sohn Eduardo das Ärzteteam leitete.
In den Händen Gottes
Im Frühjahr 1975 verschlechterte sich auch Guadalupes Gesundheitszustand. Sie wurde in die selbe Klinik aufgenommen wie ihre Mutter und am 24. Juni operiert. Trotz ihrer Schwäche besuchte sie ihre Mutter und andere Patienten, kümmerte sich um das Pflegepersonal und experimentierte im Badezimmer mit Chemikalien. Sie begegnete ihrer Situation mit großer Gelassenheit, ohne Klage, und versuchte, aus jedem Augenblick das Beste zu machen.
Zwei Tage später starb der heilige Josefmaria. Um sie zu schonen, wollte man ihr die Nachricht zunächst nicht überbringen. Schließlich sprach ihr Bruder Eduardo mit ihr: „Guadalupe! Du weißt, dass du eine schwere Operation vor dir hast, und dir ist das Risiko bewusst. Es ist wichtig, dass du vorbereitet und ruhig bleibst. Aber vorher muss ich dir eine Nachricht überbringen, die dir sehr schwerfallen wird: Gestern ist der Vater in Rom verstorben (...). Es gibt nun zwei Möglichkeiten: Entweder wirst du bald bei ihm sein und ihn an der Seite Gottes und der Jungfrau Maria sehen, oder der Vater bittet Gott, dass du hier bleibst: Beide Wege sind gut.“
Am 1. Juli wurde Guadalupe erneut operiert, und zunächst schien alles gut verlaufen zu sein. Einige Tage später wurde sie aus der Intensivstation entlassen und konnte sogar einige Schritte gehen. Am 14. Juli frühstückte und aß sie ganz normal – ihre baldige Entlassung schien greifbar. Doch gegen halb fünf Uhr nachmittags verschlechterte sich ihr Zustand plötzlich. Eduardo wurde sofort benachrichtigt.
Trotz aller ärztlichen Bemühungen trat sie in den Todeskampf ein – und selbst in diesen letzten Momenten dachte sie mehr an andere als an sich. Zu María Jesús, einer Krankenschwester auf der Herzstation, sagte sie: „Tut alles, was zu tun ist, aber mach dir keine Sorgen. Du hast alles getan, was du konntest. Ich werde dich in meinen Gedanken mitnehmen.“ Am 16. Juli 1975, dem Fest Unserer Lieben Frau vom Berge Karmel, starb Guadalupe um halb sieben Uhr morgens. Eine Woche später starb auch ihre Mutter.
Wie ein Kaleidoskop
Am 18. Mai 2019 wurde Guadalupe in Madrid seliggesprochen. Tausende Menschen aus allen Kontinenten nahmen daran teil. In einer ihrer Biografien heißt es: „Jeder Heilige spiegelt auf seine Weise, wie ein Kaleidoskop, etwas von Jesus Christus wider, der gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist.“ Im Fall von Guadalupe sind es wohl die Einfachheit, eine leidenschaftliche Liebe zu den Menschen und zur Welt, der Mut, die Fröhlichkeit und das tiefe Gottvertrauen, die der Heilige Geist durch ihr Leben aufleuchten lässt.
In gewisser Weise zeigt Guadalupe auch, wozu Frauen heute in Kirche und Gesellschaft berufen sind – eine Botschaft, die uns der Heilige Geist an ihrem Fest vor Augen führt. Nun liegt es an jedem von uns, den eigenen Weg zu erkennen und das Beste von sich selbst zum Vorschein zu bringen – „das, was Gott persönlich in ihn hineingelegt hat“ (Franziskus, Gaudete et exsultate, 11).